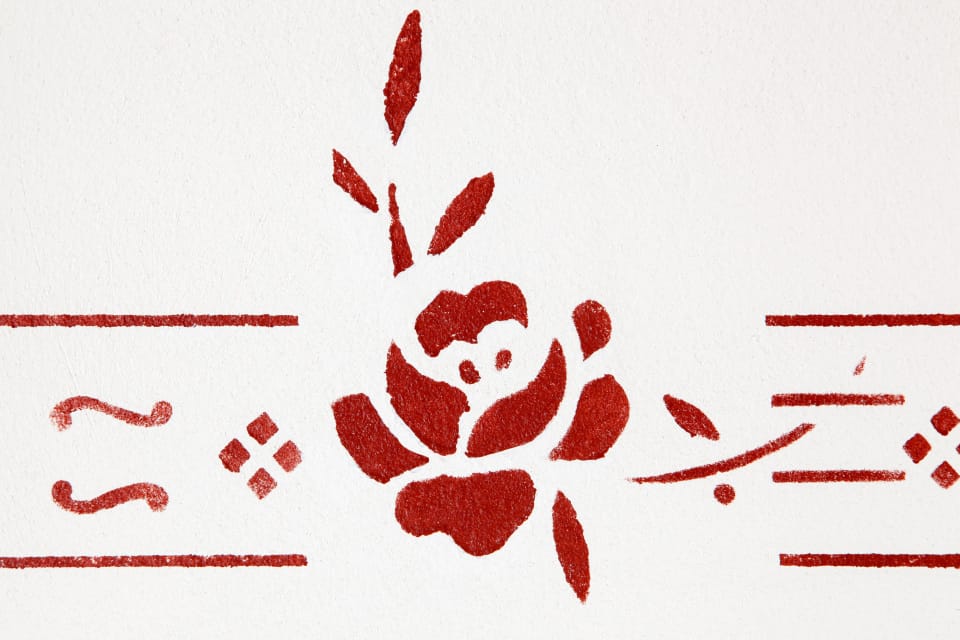Das Gebäude ist ein für die Region typischer eingeschossiger Streckhof, also ein Wohnteil mit einem Stall-Scheunen-Trakt unter einem gestreckten Dach. Der Wohnbereich im Erdgeschoss bestand aus einer großen Flurküche, in der sich der Alltag der kinderreichen Generationen abspielte, und einer Stube. In den fünf kleinen Schlafzimmern im ersten Stock mussten sich zeitweise elf Personen die Betten teilen. Da es keine Heizung gab, behalf man sich im Winter mit aufgewärmten Ziegelsteinen.
Das Haus war ziemlich heruntergekommen, und seine Tage schienen schon gezählt, als unvermutet ein Retter auftauchte: Thomas Enders, ein Nachfahre des fast namensgleichen ersten Bewohners. Der Manager wohnt zwar in Süddeutschland, aber ihm ist dieser Stammsitz seiner weit verzweigten, teils noch im Westerwald ansässigen Familie seit Kindertagen lieb und wert. Bei ihm löst das Gebäude mit der unverwechselbaren Optik nostalgische Gefühle aus: „Es erlebte Geburten und Sterbefälle, Konfirmations-, Hochzeits- und Trauerfeiern, Seuchen, Hungersnöte, Kriege, Fröhliches und Trauriges.“ Akribisch hat er die Geschichte seiner Vorfahren von 1674 bis 1970 im Westerwald recherchiert und die Ergebnisse in einem Buch über ihren Stammsitz, eben jenes „Dowwen-di“-Haus in Obermörsbach, zusammengefasst. „Dowwen-di“ bedeutet „die da oben wohnen“. Als Straßenbezeichnungen noch nicht üblich waren, orientierte man sich an den Namen, die den Häusern von den Dorfbewohnern gegeben wurden.
Thomas Enders‘ Großvater Willi war das letzte Familienmitglied gewesen, das bis 1970 im Haus gewohnt hat. Danach wechselte es mehrmals den Besitzer, zuletzt stand es leer. Von einem Cousin erfuhr der Manager, dass das marode Gebäude zum Verkauf angeboten wurde, und er entschloss sich, es für seine Familie zurück zu erwerben.
„Das Haus ist heute ein Schmuckkästchen“, sagt Architekt Markus Kober (Altenkirchen). Noch vor gut drei Jahren brauchte man allerdings viel Phantasie, um sich die Umwandlung einer Bauruine in ein Vorzeigefachwerkhaus vorstellen zu können. Selbst ein Abbruch sei angesichts der vielen Mängel mehrmals in Erwägung gezogen worden, erklärt der Architekt. Die Sanierung von Fachwerkhäusern sei ohnedies aufwendig und kostenintensiv, und wenn Thomas Enders sie nicht zu seinem Herzensprojekt gemacht hätte – wer weiß, ob „Dowwen-di“ heute noch existieren würde. „Das Haus war komplett zugewachsen, und wir mussten einiges demontieren, um den Sanierungsaufwand abschätzen zu können,“ erinnert sich der Architekt.
Beim Rückbau im Jahr 2020 wurde das Gebäude fast komplett auseinandergenommen. Nach der Untersuchung mehrerer Holzproben stand das Alter der verbauten mächtigen Eichenbalkenträger fest, und daraus wurde das wahrscheinliche Baujahr rekonstruiert: 1707. Etwa zwanzig Prozent der Balken waren so morsch, dass die Zimmerleute sie durch neue ersetzen mussten. Die Fachwerkkonstruktion des Gesamtgebäudes wurde in einzelnen Abschnitten überprüft, saniert und in Teilbereichen erneuert, alte Holzoberflächen wurden gereinigt und für den Neuanstrich vorbereitet, vorhandene Gefache – die Räume zwischen den Holzbalken, daher stammt der Begriff „Fachwerk“ – überprüft und innen- und außenseitig mit Lehmputz ergänzt oder neu aufgetragen. Zum Glück gibt es im fachwerkreichen Westerwald noch Firmen, die sich mit der Herstellung dieser Ausfachung auskennen. Die Dachpfannen, noch relativ neu, brauchten lediglich auf einer Seite ergänzt zu werden.
Alte Pläne, nach denen sich der Architekt hätte richten können, lagen nicht vor. Die Raumzuordnung erfolgte so, wie sie Thomas Enders und weiteren Verwandten in Erinnerung geblieben war. Das eigentliche Wohnhaus hat heute im 42 Quadratmeter großen Erdgeschoss eine zentrale Küche sowie eine Wohnstube und im oberen genauso großen Stockwerk einen Schlafraum. Zierleisten im Wohnzimmer und der Küche wurden mit Schablonen aus einer alten Holzkiste aufgetragen, die auf dem Dachboden stand. Das Muster besteht aus stilisierten Rosen. Stall und Scheune, ebenfalls 42 Quadratmeter groß, wurden zu einem „Eventbereich“ für Familienfeste ausgebaut. Neu hinzu kamen auf 8 Quadratmetern ein Technikraum mit Wärmepumpe und ein WC.
Da das Haus auf der Liste der Kulturdenkmäler in Mörsbach steht, wurden für den Innen- und Außenanstrich Produkte ausgewählt, die den Anforderungen des Denkmalschutzes entsprechen. Beim „Dowwen-di“-Haus kamen Histolith-Produkte von Caparol, die speziell für die Renovierung und Restaurierung von Fachwerkgebäuden und Denkmalpflege entwickelt wurden, zum Einsatz.
Zwei Farben dominieren auf den Außenwänden: das Cremeweiß in den Gefachen und das Braunrot der Holzbalken. Malermeister Justus Hassel vom Malerbetrieb Weller GmbH & Co. KG (Birnbach) hat für die Balken im Innenbereich Histolith Halböl und für die im Außenbereich Histolith Leinölfarbe verwendet. Mit Histolith Fixativ wurden die Putzfelder im Außenbereich grundiert und mit Histolith Sol Silikat Farbe, einer wetter- und lichtbeständigen Fassadenfarbe mit mineralischen Pigmenten, gestrichen. Für die Grundierung der Treppe im Innenbereich verwendeten die Maler umweltfreundlichen Caparol Haftprimer, anschließend lackierten sie sie mit Pu-Satin. Die Deckenflächen in der Scheune wurden mit Sylitol Bio-Innenfarbe verschönt, stellenweise auch die Lehmputzwände. Diese Farbe ist leicht zu verarbeiten und sorgt für gutes Raumklima. Die Außenbalken bekamen einen braunroten Anstrich mit Histolith-Leinölfarbe.
Nach zweijähriger Sanierung konnte die Einweihung gefeiert werden. Thomas Enders stellt seinen Verwandten das fertiggestellte „Schmuckstückchen“ für Zusammenkünfte zur Verfügung. Es soll für sie eine Begegnungsstätte werden, „ein Ort, an dem gelacht, gespielt und gefeiert wird und der
Zuversicht verströmt für die Zukunft, die vor uns liegt und doch keiner von uns vorausschauen kann.“
Petra Neumann-Prystaj